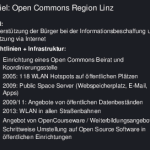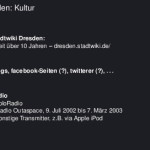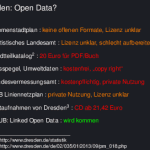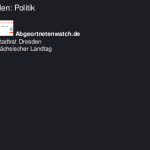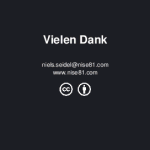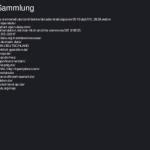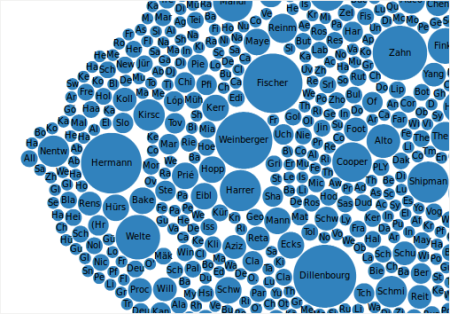Im Rahmen der eScience Saxony Lectures wird am Mittwoch 18:00 Dr. Jörg Rainer Noennig, Juniorprofessor für Wissensarchitektur an der TU Dresden, in der SLUB zum Thema:
„KNOWLEDGE_SCAPES – Neue Wissensorte und -umgebungen im digital vernetzten urbanen Raum“
referieren.
Der öffentliche Vortrag findet im Vortragssaal der SLUB Dresden ab 18:00 Uhr statt und wird per Livestream (Anmeldung als “Gast”) im WWW übertragen.