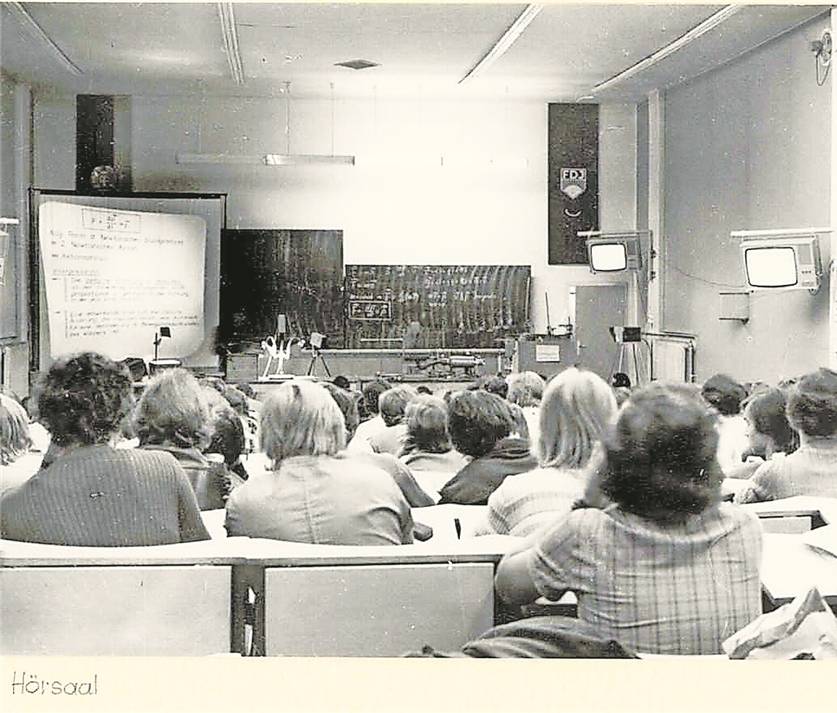Es ist nun schon gut sechs Monate her, dass uns die crowd bei der Digitalisierung des NS-Propagandafilms »Theresienstadt – Eine Dokumentation aus dem Jüdischen Siedlungsgebiet« unterstützt hat. Seit dem habe ich zwei größenen Schüben die Inhalte und Umgebung für ein Lernumgebung entwickelt, die ich just am Sonnabend zum zweiten mal zur Diskussion stellte.
Beim diesjährigen Willkommens- und Abschiedsseminar trafen sich die derzeitigen und neuen Freiwilligen der Aktion Sühnezeichen Friedensdienst sowie die Freiwilligen vom Österreichischen Gedenkdienst in Dresden. Der Ort war gut gewählt, Read More