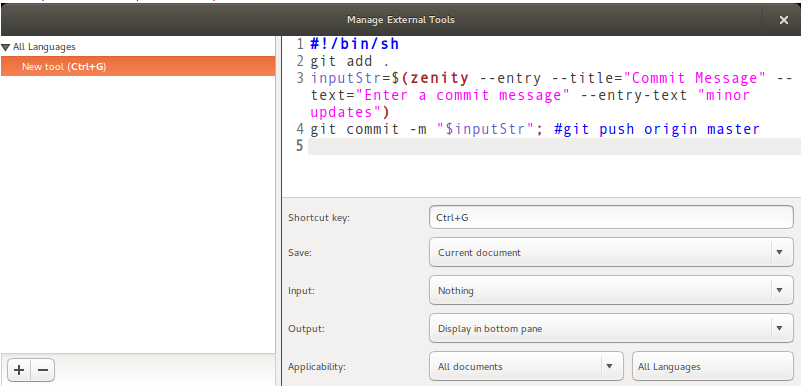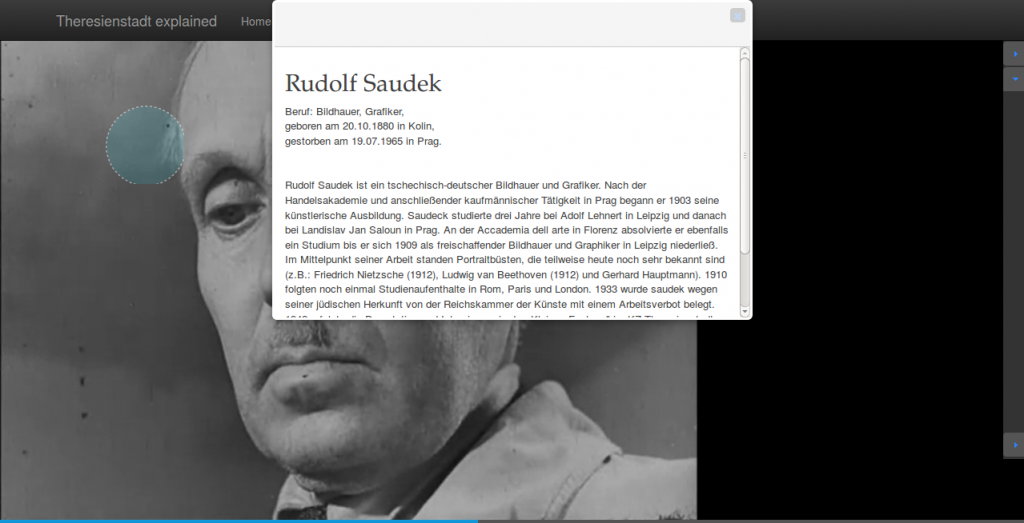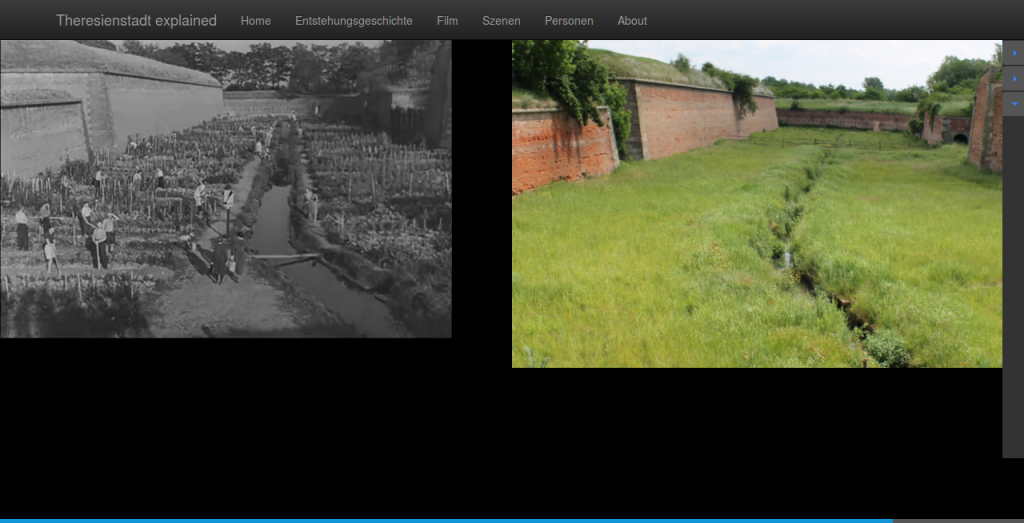1. Anti-Pattern: Mikrofinanzierung
Die Freiheit von Forschung und Lehre ging früher wohl einmal mit der finanziellen Freiheit einher, das Budget einer Professur im Sinne der Kernaufgaben auszugeben. Mit der Umstellung auf Drittmittelforschung konnte man sich diese Freiheit zumindest noch erkämpfen, in dem man gute Anträge schrieb und sich gegenüber der Konkurrenz behauptete. Da gewisse Drittmittelgeber nur nur bestimmte Kostenstellen finanzieren, können in den anderen Kostenstellen Lücken aufklaffen. Beispielsweise sind Reisemittel oft ausgschlossen oder auf eine bestimmte Region (Deutschland) beschränkt, während Forscher gleichzeitig zur Internationalisierung und zum Aufbau internationaler Kontakte angehalten sind. Um ein solches Loch im Drittmittelsack zu stopfen gibt es kleinere Finanzierungsmöglichkeiten, z.B. beim DAAD, der DFG oder an den Universitäten (z.B. die Graduierten Akademie der TU Dresden). Diese Mikrofinanzierungen betreffen aber auch Zuschüsse für Hilfskräfte, die dann eigenständig und freilich ohne Zuarbeit eine Forschungsfrage beantworten. In ähnlicher Weise können auch minimale Aufstockungen, etwa um 25% der Vollzeitäquivalente, als eine Mikrofinanzierung angesehen werden.
Eine weitere Konsequenz entsteht bei der Verwertung der Projektergebnisse. Durch die Zerstückelung von Stellen und Aufgaben kann ein erzieltes Ergebnis nicht mehr einwandfrei mit einem Projekt in Zusammenhang gebracht werden. In Folge verwertet man seine Ergebnisse (z.B. Publikationen) in mehreren Projektberichten. Im Extremfall ist das Subventionsbetrug, zumindest erzeugt es jedoch Redundanzen in Abschlussberichten.
2. Anti-Pattern: Wer nicht will der hat schon
Die Fakultäten erhalten in Sachsen nur 90% der ihnen zugesagten Mittel, wobei einzelne Professuren (oder Verbünde) um die fehlenden 10% der Mittel in Antragsverfahren miteinander konkurrieren. Wer sich also nicht um diese Mittel bemüht, d.h. sich am Vergabeverfahren beteiligt, geht einfach leer aus. Lehrstühle sollen damit die Initiative ergreifen und sich um eine Fortentwicklung von Lehre, Forschung und Organisation bemühen. Business as usual wird damit bestraft und Handlungsspielräume werden eingeschränkt. Da dieses Prinzip die ungleiche Kapazitäten und Belastungen einzelner Lehrstühle nicht berücksichtigt, ist eine Chancengleichheit nicht gewährleistet. Für den Ablauf des Begutachtungsverfahrens ist das Ministerium verantwortlich, d.h. von Fairness und Objektivität ist auszuegehen.
3. Anti-Pattern: Matroschka- oder Schneeball-Prinzip
Projektverantwortliche starten innerhalb ihres Drittmittelprojekts eine Ausschreibungen, um kleinere Geldbeträge nach selbst definierten Kriterien innerhalb einer bestimmten Zielgruppe zu verteilen. Wer diese Gelder bekommen möchte, muss sich mit einem Antrag darum bemühen und die Kriterien erfüllen. Was früher eine Stellenausschreibung war, sind hier die Förderrichtlinien. Statt eines Bewerbungsschreibens, wird ein Antrag eingereicht. Das Begutachtungsverfahren unterliegt keiner Kontrolle und werden in der Regel durch assoziierte Personen und Projektmitarbeiter getragen. Die üblichen Hüter der Chancengleichheit für Frauen und Menschen mit Behinderung, bleiben außen vor. In der Regel ergeben sich daraus nur sehr kurzfristige Finanzierungen von Wissenschaftlichen Mitarbeitern oder Hilfskräften mit limitierten Sach- und Reisemitteln.
4. Ein Vorschlag für eine Metrik der Drittmitteleinwerbung
Der Dschungel verschachtelter und kleinteiliger Fördermöglichkeiten nimmt zunehmend mehr Zeit in Anspruch. Um dieses subjektive Empfinden zu quantifizieren, schlage ich einige Kennzahlen vor, die jeder für sich oder für seine Struktureineinheit erheben kann. Interessant ist daran nicht nur der Vergleich zwischen verschiedenen Personen oder Abteilungen unter dem Dach einer Hochschule, sondern auch der Längsschnitt über meherere Jahre hinweg. Dem einzelnen können diese Zahlen vielleicht helfen, den Blick auf das Wesentliche, d.h. die Kernaufgaben, wieder zu schärfen und dem Hamsterrad der Drittmittel zu entkommen. Es wäre zu begrüßen, wenn wir im Sinne dieser Kernaufgaben wieder effizienter arbeiten könnten, anstatt massenhaft Antragsprosa im Markettingsprech zu formulieren.
Die folgenden Vorschläge für Metriken beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr und alle eingereichten Drittmittelanträge, einschließlich mehrstufiger und nicht erfolgreicher Anträge.
- Geschriebene Zeichen im Antragstext (zzgl. Zwischen-/Abschlussbericht) pro eingeworbenem Euro.
- Verhältnis der in Anträgen geschriebenen Zeichen (zzgl. Zwischen-/Abschlussbericht) zur Zeichenanzahl aller Publikationen.
- Kumulierte Anzahl der Manntage für Planung, Erstellung von Anträge pro eingeworbenen Manntage.
- Summe der Manntage, an welchen man sich mit der Planung, Erstellung von Anträge bzw. der Berichterstattung beschäftigt hat.
5. (Dritt-)Mittel der Wahl?
Im kleinen Hamsterrad im Getriebe der Hochschulen muss man sich schön mitdrehen, funktionieren. Aus anderen Ländern wissen wir jedoch, dass dieses System nicht alternativlos ist. Für klassische Finanzierung eines Mittelbaus machen sich bereits Mittelbauinitiativen stark, doch es gibt auch alternative Möglichkeiten Forschung und Lehre jenseits der Hochschulen zu betreiben. Vielleicht ist letzteres auch gewollt, um die fähigen Leute in die Arme der Wirtschaft zu spielen. Wenn jedoch das Ziel darin besteht, Forschung und Lehre zu bestreiten, gibt es sicher noch weitere Alternativen. Ich versuche es mal mit einer Auflistung:
- Forschung durch Bürgerwissenschaft. Siehe http://www.buergerschaffenwissen.de/
- Lebenslanges Lernen (und Lehren) anhand freier Lernressourcen, Forschungsergebnisse, …
- Studentische Initiativen, die durch eigene Lehrangebote von der üblichen Lehrmeinung in den Wirtschaftswissenschaften abrücken. Siehe Impuls, Internationale studentische Initiative für Pluralismus in der Ökonomie (ISIPE)
- Der Versuch das Konzept der Klöster auf eine atheistische Art und Weise neu zu erfinden ist mit den unMonastery wohl gelungen. Klöster waren im Mittelalter, weit vor der Gründung der ersten Universitäten, die einzigen Orte, in denen Menschen geforscht und gelehrt haben. Die strikte Lebensführung, sowie die Kombination aus körperlicher Arbeit (neudeutsch Sport) und Kopfarbeit erscheint auch in der heutigen Zeit weniger ungewöhnlich, als man glaubt.