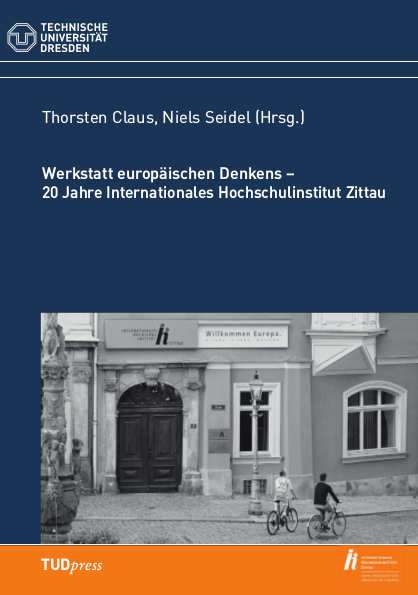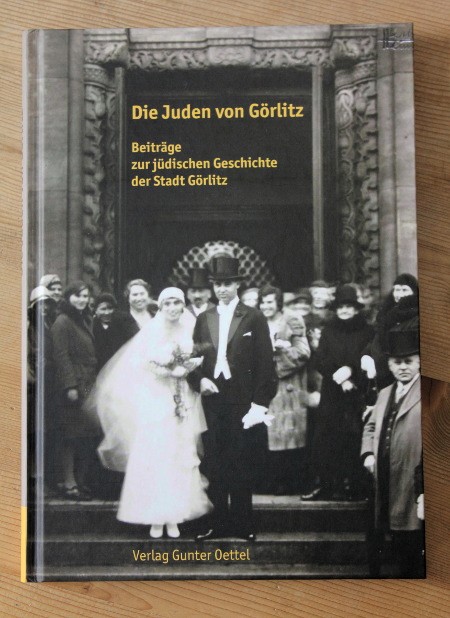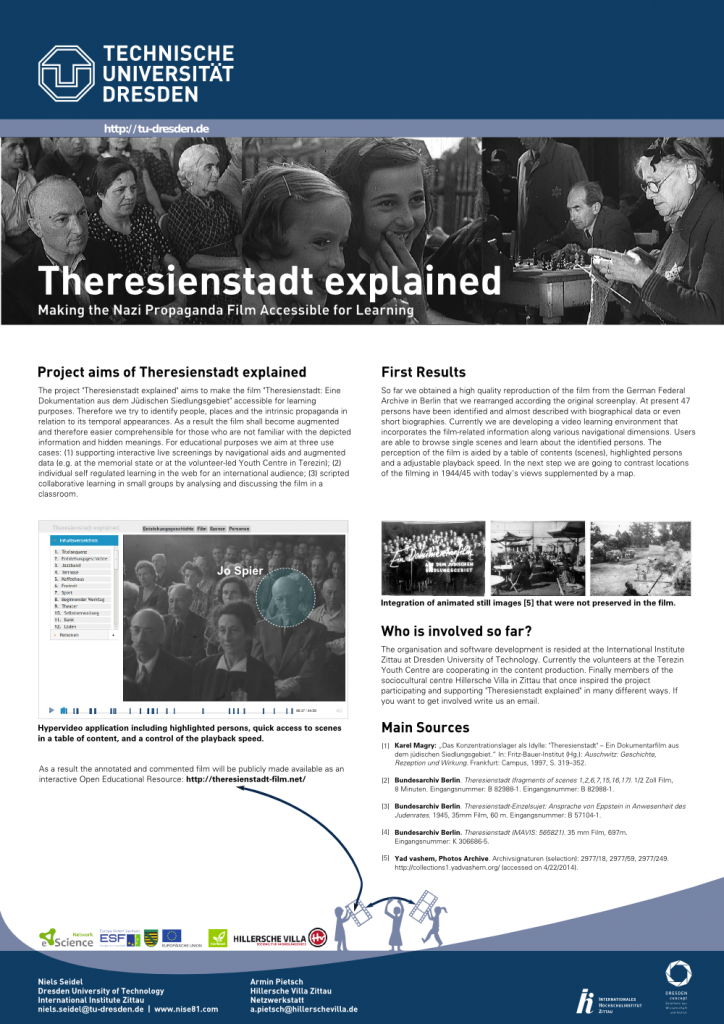Unter dem Titel »Werkstatt europäischen Denkens – 20 Jahre Internationales Hochschulinstitut Zittau« haben wir dieser Tage einen Sammelband mit 22 Beiträgen von Zittauer Doktoranden bei TUDpress und Qucosa herausgebracht. Kern dieser Festschrift sind die beiden Beiträge der Professoren Albert Löhr und Thorsten Claus, die über die Entwicklung des IHI Zittau sowie das dort etablierte kooperative Promotionsmodell berichten. Ergänzt werden die Ausführungen durch die Chronik der einstigen unabhängigen universitären Einrichtung, die heute eine Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung der Technischen Universität Dresden ist.
Der gesamte Band steht unter Creative Commons Lizenz (cc by) und ist über die Open Access Plattform Qucosa (hoffentlich) auch längerfristig verfügbar: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-152171