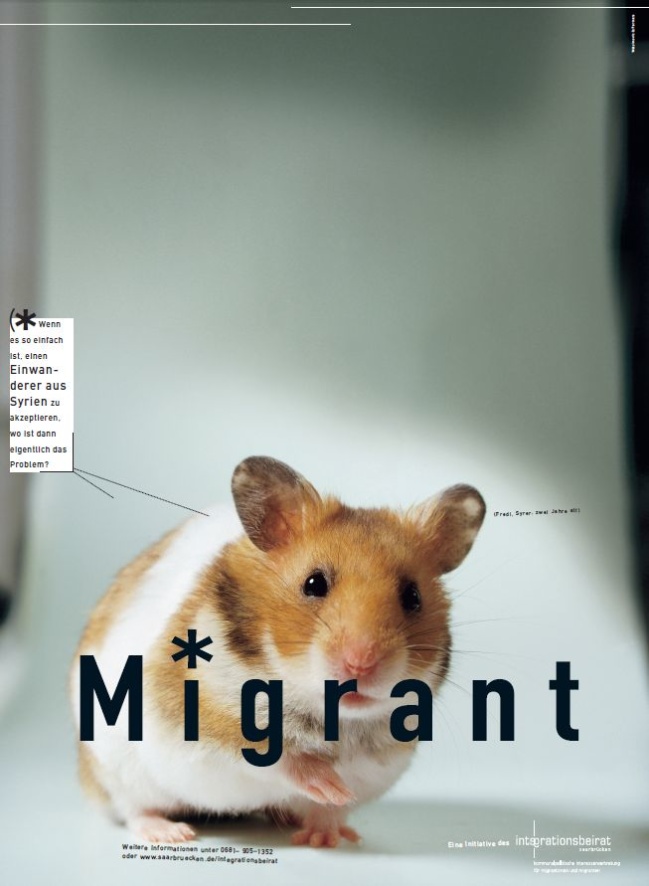Der Grundkörper des klassische Herrnhuter Sterns ist ein 26-seitiger Rhombenkuboktaeder, der aus 18 Quadraten und 6 Dreiecken besteht. An einer Seite hängt das Lämpchen drin, so dass nur 25 Zacken vorhanden sind. Bastelanleitungen für den Grundkörper findet man beispielsweise hier. Original Herrnhuter Sterne sind jedoch markenrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne Lizenz angefertigt werden. Das eigentliche Original dieser Weihnachtssterne hatte jedoch 110 Zacken und wurde 1820 von Christian Madsen in Niesky, also 30 km nördlich von Herrnhut erfunden. Ein Exemplar dieses Sternentyps hängt heute noch in der Herrnhuter Kirche. Ein Gruppe von Bastlern fertigte diesen in aufwendiger Handarbeit. In den USA lud ein gewisser Max Brady Kurse zum Bau der 110-Zacker ein. Doch die Bauanleitungen sind nicht frei verfügbar. In dem Buch über Bauweisen verschiedener Herrnhuter Sterne fehlt der 110-Zacker. Den Fotos nach zu urteilen, besteht der 110-Zacker jedoch höchstens aus achteckigen und etwas kleineren sechs- und viereckigen Flächen. Aufgrund der 110 Flächen wirkt der Grundkörper wie eine kantige Kugel. In diesem Beitrag möchte ich die Frage beantworten, wie sich ein 110-Zackiger Stern und insbesondere sein Grundkörper konstruieren lässt.
Im Folgenden beschreibe ich zunächst wie sich aus einem 6-Zackigen Stern mit einem Würfel als Grundkörper, ein Rhombenkuboktaeder, dass heißt ein Grundkörper für einen Herrnhuter Stern konstruieren lässt. Mit Hilfe mathematisch-geometrischer Formeln und etwas Kombinatorik erweitern wir anschließend den Rhombenkuboktaeder zu einem Grundkörper mit 110 Flächen. Daraus ergibt sich eine Bastelanleitung für den 110-Zacker, bei der man die Seitenlänge selbst bestimmen kann. Der Beitrag schließt mit einigen Überlegungen zu den Größenverhältnissen der Sterne und der daraus resultierenden wahrgenommenen Ästhetik.
6-Zacker mit einem Würfel als Grundkörper
Der sechsseitige, regelmäßige Grundkörper ist trivial. Für Kinder lässt sich ein solcher Stern recht einfach bauen. Als Grundkörper nimmt man einen Würfel, bspw. mit einer Kantenlänge von 4 cm. Beim Aufzeichnen der Mantelfläche sollten Klebefalze bedacht werden. In jede Seitenfläche ist ein mittiger Kreis mit einem Radius von 1,5 cm zu schneiden, um die Zacken von Innen hindurch führen zu können. Die sechs Zacken schneidet man aus einem Kreis mit einem Radius von 7 cm aus. Für jede Zacke bedarf es eines Kreissegments von 54°.
26-Zacker mit Grundkörper eines Rhombenkuboktaeder
Um aus einem würfelförmigen Grundkörper einen 26-flächigen Rhombenkuboktaeder zu erzeugen, ersetzt man jede der sechs quadratischen Seitenflächen des Würfels durch jeweils drei kleinere, L-förmig angeordnete Quadrate. Dadurch entstehen insgesamt 18 neue quadratische Flächen. Die ursprünglichen Ecken des Würfels werden durch Dreiecke ersetzt, die zwischen den angrenzenden kleinen Quadraten aufgespannt werden. Auf diese Weise erhält der Rhombenkuboktaeder zusätzlich 8 dreieckige Flächen. Insgesamt besitzt der so entstandene Körper also 18 quadratische und 8 dreieckige Flächen, was zu den insgesamt 26 Flächen führt.
Um zu überprüfen, ob es sich bei dem Rhombenkuboktaeder um einen konvexe Polyeder handelt, nutzen wir die Euler-Charakteristik zur Probe. Die Formel besagt: Flächen + Ecken – Kanten = 2. Der Rhombenkuboktaeder hat 18 quadratische Flächen und 8 dreieckige Flächen Insgesamt hat er somit 18 + 8 = 26 Flächen. Der Rhombenkuboktaeder hat insgesamt 24 Ecken. Das ergibt sich aus der Struktur des Körpers, da jede Ecke des ursprünglichen Würfels durch die Verbindung von Dreiecken und Quadraten zu neuen Ecken führt. Jede quadratische Fläche hat 4 Kanten, insgesamt für 18 Quadrate: 18 × 4=72. Jede dreieckige Fläche hat 3 Kanten, insgesamt für 8 Dreiecke: 8 × 3 = 24. Da jedoch jede Kante zwischen zwei Flächen liegt, wird jede Kante doppelt gezählt. Die Gesamtzahl der Kanten beträgt also (72 + 24) / 2 = 48 Kanten.
Setzen wir die Werte ein: Flächen + Ecken − Kanten = 26 + 24 − 48 = 2. Die Probe für diesen Vertreter eines konvexe Polyeder mit der Euler-Charakteristik war somit erfolgreich.
110-Zacker: Das Original mit 110 Zacken

Ausgangspunkt für den 110-Zacker ist der zuvor konstruierte 26-flächige Rhombenkuboktaeder. Dieser besteht aus 8 Dreiecke und 18 Vierecke und hat somit Insgesamt 26 Flächen. Die ursprünglichen 8 Dreiecke werden jeweils so modifiziert, dass sie zu Sechsecken (S) erweitert werden. Dies geschieht, indem je zwei neue Kanten an den ursprünglichen Dreiecksseiten hinzugefügt werden. Die ursprünglichen 18 Vierecke werden zu Achtecken (A) erweitert, indem jede Ecke des Vierecks “abschnitten” wird.
An jeder Kante zwischen den neu entstandenen Sechsecken und Achtecken wird ein weiteres Quadrat (Q) eingefügt, um die Flächenzahl zu erhöhen und die Struktur weiterhin konvex (nach außen gewölbt) zu halten. Damit ist der 110-Zackige Grundkörper aber noch nicht vollständig.
Ob auch der 110-flächige Grundkörper ein konvexer Polyeder ist können wir wieder mit der Euler-Charakteristik überprüfen: Flächen + Ecken − Kanten = 2. Die Anzahl der Fläche ist mit 110 gegeben. Jede Fläche hat eine bestimmte Anzahl von Kanten K, und jede Kante wird zwischen zwei Flächen geteilt. K = 1/2 * (A * 8 + S * 6 + Q * 4). Die Anzahl der Ecken E: E = (2 * K) / Anzahl_Kanten_pro_Ecke. Da an jeder Ecke drei Kanten zusammentreffen, ergibt sich für E: E=2/3 * K.
Wir beginnen zunächst damit die Variablen in der Euler-Charakteristik zu bestimmen: F + E – K = 2. Wir wissen, dass F, die Summe aller Flächen, 110 betragen soll, d.h. F = A + S + Q = 110. Der Zusammenhang zwischen der Anzahl an Ecken E und Kanten K ist ebenfalls bekannt, da sich an jeder Ecke immer genau drei Kanten treffen und jede Kante mit zwei Ecken verbunden ist. Es gilt somit E = 2/3 * K. Wir können F und E somit in die Formel der Euler-Charakteristik einsetzen und erhalten: 110 + 2/3 * K – K = 2. Für K, die Anzahl an Kanten ergibt sich der Wert 324.
Wir wissen damit noch nicht, aus wie vielen Achtecken A, Sechsecken S und Quadraten Q der Grundkörper besteht. Mögliche Werte für A, S, Q und K müssen jedoch ganzzahlig und, aufgrund der Symmetrieeigenschaften der konvexen Polyeder, durch 2 teilbar teilbar sein. Wir können zudem annehmen, dass es von jeder Form mindestens 8 Flächen gibt, da bereits der Rhombenkuboktaeder mindestens 8 Flächen einer Form hat. Rechnet man nun alle verbleibenden Kombinationen von A, S und Q durch, ergeben sich 19 verschiedene Kombinationen für die Werte, so dass deren Summe F = 110 beträgt. Die Werte für A steigen in 2er-Schritten von 14 bis 44. S fällt in 2er-Schritten von 76 bis 16, während Q in der gleichen Schrittfolge von 20 bis 50 steigt. Folglich gibt es theoretisch keine eindeutige Lösung und nicht nur eine Möglichkeit, einen 110-seitigen Grundkörper zu bilden. Es kann jedoch angenommen werden, dass weitaus weniger als 19 Kombinationen von A, S, und Q gibt, die sich geometrisch zu einem kugelartigen Körper zusammensetzen lassen. Aus dem obigen Foto des Skeletts kann man entnehmen, dass es mehr Sechsecke, als Achtecke und Vierecke gibt. Damit reduziert sich die Anzahl an möglichen Kombinationen auf 12.
| Anzahl Achtecke (A) | Anzahl Sechsecke (S) | Anzahl Quadrate (Q) |
| 14 | 76 | 20 |
| 16 | 74 | 22 |
| 18 | 72 | 24 |
| 20 | 70 | 26 |
| 22 | 68 | 28 |
| 24 | 66 | 30 |
| 26 | 64 | 32 |
| 28 | 62 | 34 |
| 30 | 60 | 36 |
| 32 | 58 | 38 |
| 34 | 56 | 40 |
| 36 | 54 | 42 |
| 38 | 52 | 44 |
| 40 | 50 | 46 |
| 42 | 48 | 48 |
| 44 | 46 | 50 |
Man erkennt auf dem Foto, dass die beiden sich drei mal im rechten Winkel kreuzenden und den Körper umspannenden Bänder aus der Folge A, Q, S, S, Q, A, Q, S, S, Q, A, Q, S, S, Q, A, Q, S, S, Q bestehen. Folglich gibt es mindestens 6*A, 16*S und 16*Q. Jedes Achteck berührt an den Diagonalen weitere vier Achtecke, so dass es mindestens 6 * 5 Achtecke geben muss.
Anhand dieser Einschränkungen bleibt nur eine der theoretischen Lösung übrig, demnach der 110-Seitige Grundkörper aus 32 Achtecken, 40 Sechsecken und 38 Quadraten besteht. Die Abmessungen der Flächen sind einfach festzulegen, da alle Seitenlängen der drei Flächen gleich lang sind und es sich um regelmäßige Vielecke handelt, deren Seitenflächen alle gleich lang sind.
Überlegungen zu den Größenverhältnissen
Die konkreten Abmessungen von Grundkörper und Zacken kann man einer Variante des Herrnhuter Originals entnehmen. Anhand der mittlerweile großen Produktpalette fällt auf, dass es spitzere und gedrungenere Varianten des Sterns gibt.
| Durchmesser Grundkörper | Lange Zacke | Kurze Zacke | Verhältnis Körper-Zacke | Verhältnis Zacken |
| 11,4 | 14,3 | 9,5 | 0,8 | 1,5 |
| … | ||||
| … |
Es gibt dabei zwei interessante Größenverhältnisse, die sich auf die wahrgenommene Ästhetik eines Sterns auswirken. Zum einen ist es das Verhältnis aus der Größe des Grundkörper und der Länge der (längsten) Zacken. Zum anderen ist es das Längenverhältnis der unterschiedlichen Zacken. Anstatt diese Verhältnisse zufällig oder per Augenmaß zu bestimmen, gibt es jedoch in der Kunst und Gestaltpsychologie bewährte Größenverhältnisse wie den Goldenen Schnitt, die auch bei den Herrnhuter Sternen zur Anwendung kommen könnten. Tatsächlich beträgt das Verhältnis zwischen Grundkörper und Zacke 0,8. Auch zwischen den Zacken ist ein Verhältnis von 1,5 festzustellen.
Diese Verhältnisse orientieren sich also nicht am Goldenen Schnitt. Dazu müsste die Länge der Zacken im Verhältnis von 1,618 zueinander stehen. Hat der Grundkörper beispielsweise einen Durchmesser von 10 cm, so sollten die langen Zacken etwa 16,2 cm und die kleinen ebenfalls 6,2 cm lang sein. Ob Sterne mit diesen Größenverhältnissen gedrungen oder abstoßend spitz wirken, käme auf einen Versuch an.
Zu guter Letzt bleibt die Frage, wie viele Zacken ein schöner Weihnachtsstern überhaupt braucht. Die Wahrnehmung beeinflussen hierbei die empfundene Einfachheit in Abgrenzung zu einem trivialen vierzackigen Stern. Einfachheit kann durch die Anzahl unterschiedlicher Flächen des Grundkörpers und somit auch der Anzahl unterschiedlicher Zacken bestimmt werden. Während nur eine Fläche und Zacke wie beim vierzackigen Stern zu simple oder trivial erscheint, gewinnt der 26-seitige Grundkörper mit den zwei unterschiedlichen Zacken an Interessantheit. Dies nicht zuletzt, weil seine Form bereits nach kurzer Betrachtung nachvollziehbar ist. Beim 110-Zacker ist dies nicht mehr unbedingt der Fall, da allein regelmäßige Achtecke, anders als Vier- oder Sechsecke, von den meisten Menschen nicht mehr als eine Einheit erfasst werden können. Man beginnt die Kanten oder Ecken zu zählen und muss sie aufmerksam von den ähnlich erscheinenden Sechsecken differenzieren.
Angesichts der hohen Zahl von Flächen bleibt ohnehin die Frage, ob die Betrachter:innen den komplexen Körper nicht ohnehin zu einer Kugel ergänzen. In der Gestaltpsychologie ist dieses Phänomen als Gesetz der Prägnanz bekannt. Es besagt, dass das menschliche Wahrnehmungssystem dazu tendiert, einfache, regelmäßige und symmetrische Formen zu bevorzugen und komplexe oder unregelmäßige Formen in möglichst einfache, bekannte Strukturen zu organisieren. Konvexe Polyeder werden demnach als Annäherungen an die Form einer Kugel wahrgenommen – ganz gleich wie viel Mühe wir uns mit der Konstruktion konvexer Polyeder geben. Der Herrnhuter Stern ist oberflächlich betrachtet also eine mit Zacken verzierte Kugel. Dennoch stellt der Grundkörper dieses Sterns einen guten Kompromiss dar, um als Kugel wahrgenommen und trotzdem mit einfachen geometrischen Formen konstruiert und gefertigt werden zu können.
Symmetrie ist eine weitere, die ästhetische Wahrnehmung bestimmende Eigenschaft. Während Symmetrie in der Fläche für uns leicht zu erfassen ist, bedarf zur Erkennung von Symmetrie in räumlichen Gegenständen eine Betrachtung von mehreren Seiten. Auch hier erschwert die zunehmende Anzahl unterschiedlicher Flächen, das Erkennen von Symmetrie. Während der 26-Seitige Grundkörper drei Bänder aus quadratischen Flächen aufweist, sind es beim 110-Seitigen Grundkörper schon Reihen von drei unterschiedlichen Flächen, die ein oder auch zwei mal in Folge auftreten können. Der Herrnhuter Stern in seiner verbreiteten Variante ist also ein guter Kompromiss zwischen einfachen Formen und gerade noch erfassbaren geometrischen Formen. Das Produkt stellt einen notwendigen Anspruch an die Betrachter, überfordert sich jedoch (zumeist) nicht. Der 110-Zacker bleibt hingegen der Auffassungsgabe voraus und deshalb dem Ladentisch fern.